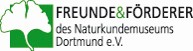
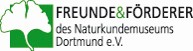
Verein | Exkursionen | Projekte | Vorträge | Termine | Neues vom Museum | Naturfotografien | Impressum | Datenschutz
Nach der Reise in die Vergangenheit von Jahrmillionen in
der Sonderausstellung „Jurassic Harz“ unternahm die Exkursionsgruppe
des Fördervereins zum Abschluss des 1. Exkursionstages im
Rahmen einer Nachwächterführung eine Reise in die Vergangenheit einiger
Jahrhunderte bzw. in die Gegenwart durch eine Begehung
einiger Passagen der Braunschweiger Altstadt.
In traditioneller Kleidung begrüßte Thomas Ostwald die Exkursionsgruppe
als „Nachtwächter Rudolf“ und setzte in der Kuhstraße
mit seiner interessanten, unterhaltsamen und lehrreichen Führung
ein.
Der Altstadtring des mittelalterlichen Braunschweigs
führte insbesondere unter dem Sachsen- und Bayernkönig Heinrich dem Löwen
die Weichbilder Alte Wiek, Hagen, Neustadt, Altstadt und in der
Mitte Sack zusammen. Alle mit Ausnahme von Sack hatten eine
eigene Pfarrkirche für die Bürger. Sack hatte den Dom, aber den
beanspruchte Heinrich der Löwe für sich und seinen Adel. Die Bürger
von Sack mussten in die Kirche im Stadtteil Altstadt
ausweichen. Das nennt man Sicherung des Löwenanteils. Der
Welfe Heinrich der Löwe besaß als Herzog von Sachsen ein riesiges
Herzogtum mit den Teilen Westfalen, Engern und Ostfalen. Und er war
Herzog von Bayern. Zum Abschluss seiner Regentschaft blieb ihm
nur das Herzogtum Braunschweig/ Lüneburg. Die Herzöge von
Braunschweig waren bei den Bürgern bis zum 18. Jahrhundert nie so ganz gut
angesehen, vielleicht hat das seinen Ursprung schon bei Heinrich dem
Löwen gehabt. Irgendwann sind die Herzöge nach Wolfenbüttel ausgewichen,
hatten genug von den stolzen Bürgern der Hansestadt Braunschweig.
1671 kam Herzog Rudolf August mit Waffengewalt zurück und zog wieder ins
Braunschweiger Schloss ein. Später hatten die Herzöge und ihre Bürger ein
besseres gegenseitiges Verständnis.
Das Gebiet um Braunschweig war schon früh besiedelt. Archäologisch ist die
Stadt grundsätzlich bereits im 9. Jahrhundert n. Chr.
entstanden, aber ohne Papiere geht gar nichts: Urkundlich ist
Braunschweig erst ab 1031 im Zuge der Weihe der Magni-Kirche belegt,
in der Urkunde als Brunesgui. Entsprechend ist 1031 das Gründungsdatum der
Stadt.
Der Name Braunschweig leitet sich wahrscheinlich aus Brunswiek
ab. Ein „gerodeter Handelsplatz“ neben Dankwarderode auf
der anderen Seite der Oker. Heinrich der Löwe ließ die Oker durch
künstliche Gräben um die Stadt fließen und eine Stadtmauer errichten.
Erweitert wurde die Stadtmauer von Otto, dem Sohn Heinrichs des Löwen.
Otto war der einzige Welfen-Kaiser des Heiligen Römischen Reiches
Deutscher Nation. Von der Stadtmauer ist heute nichts mehr zu sehen, aber
die Stadtgräben verleihen der Stadt einen großartigen Grüngürtel und einen
hohen Freizeitwert. Die Oker selbst ist im Stadtgebiet in einen
unterirdischen Kanal gezwängt. Thomas Ostwald hofft, dass dieser
unterirdische Kanal demnächst durch die Öffentlichkeit begehbar gestaltet
wird.
Am Klint erreichte die Fußtruppe den mit 72 m höchsten Punkt der Altstadt. Die Braunschweiger Altstadt wurde in einem Bombenangriff am 14. und 15. Oktober 1944 zu 80 % zerstört. Hier sieht man noch historische Fachwerkhäuser. Mit dem besonderen Reiz, dass sie den stolzen Bürgerwillen zeigen: Die Häuser stehen mit der breiten Seite nach vorne. Die Herzöge sollten erkennen, wie einflussreich die Hansestädter waren.
Etwas weiter in der Schlossstraße das älteste inschriftlich datierte Fachwerkhaus Deutschlands Am Ackerhof, 1432 errichtet. Das Haus ist heute in einem etwas bedauerlichen Zustand, aber Schrifttafeln zeigen, dass die Absicht besteht, es wieder erstrahlen zu lassen. Wenn die Finanzierung steht. Hier muss wohl wieder eine Stiftung den entscheidenden Anstoß geben.
Auf der anderen Straßenseite des Ackerhofes war genügend Geld da. Für ein Hundertwasserhaus, das aber kein Hundertwasserhaus ist, es sieht nur so ähnlich aus. Entworfen vom Künstler James Ritzi, umgesetzt vom Architekten Konrad Kloster. Das „Happy Ritzi Haus“ ist vertraglich festgelegt das einzige Haus, das von Ritzi so entworfen werden durfte. Es wurde jahrelang als Bürogebäude insbesondere für neue Firmengründer genutzt, heute nutzt es Friedrich Georg Knapp, Chef der Bekleidungskette New Yorker.
Die Magnikirche war
als Keimzelle der Stadtgründung schon erwähnt. Zu Zeiten Luthers war
sie eine Keimzelle der Reformation. Im Zuge des Wiederaufbaus der
Stadt nach 1945 war sie Keimzelle des Widerstandes gegen verrückte
Stadtplaner und heute sie eine offene Kirche für Quartier und Stadt.
Die Magnikirche hat einen Bombenangriff im April 1944 nicht standgehalten,
nur noch Turm und Säulen des Langhauses stnden. 1946 hatten
Stadtplaner die Absicht, eine große Straße direkt an der Kirche
vorbei zu führen und auch den Platz und die Fachwerkhäuser zu
opfern. Durchgesetzt hat sich dann aber die Fakultät der
Fachwerkhäuser- Bewahrer. Alles was an Fachwerk noch da war, blieb
erhalten. Die im Inneren modern wiederaufgebaute Kirche hat diesen Planern
ein Denkmal durch eine fensterlose Südseite gesetzt. Errichtet
wurde die Kirche aus zwei verschiedenen Sandsteinen. Der etwas
weiche und rötliche Stein wurde im Nußberg gewonnen (etwa 5 km von
Braunschweig entfernt, heute Geopunkt Nußberg, Ostfalen), der andere
Stein, ein heller und fossilreicher Kalkstein der mittleren Trias
(Muschelkalk)Stein aus dem Höhenzug Elm, etwa 30 km von Braunschweig
entfernt.
Nördlich der Magnikirche stehen interessante Fachwerkhäuser. Ein Haus besteht aus Elementen der Gotik und der Renaissance mit einem eingesetzten Spruchbalken. Ein Ergebnis der Auseinandersetzungen der Bürger mit Adel und Klerus. Daneben ein Haus mit einer sehr schiefenersten Etage. Das kommt, wenn man kein abgelagertes Holz als Baustoff einsetzt.
Etwas weiter die Herrendorf Twete. Twete ist ein Begriff aus dem Ostfälischen für eine kleine Gasse. Davon gab es in Braunschweig vor dem Bombenangriff viele, die Herrendorf Twete ist als einzige verblieben.
Über die Oker geht es danach zum Schloss. Leider bemerkt man den Übertritt über den unteririsch kanalisierten Fluss nicht. Das Residenzschloss wurde 1717 von Hermann Korb errichtet, richtig fertig war es aber erst 1791. Am 7. September 1830 kam es zu einer Revolution in Braunschweig. Bürger rebellierten gegen Herzog Karl II., den sie „Diamantenherzog“ nannten. Im Zuge dieser Revolution brannte das Schloss ab. Der zweite Bau stand ab 1841. Dieser wurde durch die Luftangriffe stark beschädigt und 1960 abgerissen. Die Vorderfront und ein Seitengebäude für Stadtarchiv und Bibliothek wurden vor 10 Jahren neu aufgebaut, als Kompromiss zwischen der Stadt und dem ECE-Projektmanagement, die hier das Einkaufszentrum „Schloss-Arkaden“ errichtet hat und die Schloss-Komponenten zu Lasten ECE gebaut hat. Ca. 600 Originalteile konnten verwendet werden, neue Steine sind aus dem Reinhardtsdorfer Sandstein aus Sachsen und aus dem Hohenzollernpark-Sandstein aus Polen. Weitere Originalteile konnten nicht verwendet werden, sie sind aber weiterhin zwischengelagert. Für das Archiv und die Bibliothek zahlt die Stadt Miete. Die Stadtbibliothek hat sich zwischenzeitlich mit ihrem digitalen Schwerpunkt zu einer begehrten Bibliothek entwickelt und stellt eine starke Ergänzung zu der weltberühmten Anna-Amalia-Bibliothek in Wolfenbüttel dar.
Die größte Quadriga Europas hat eine verrückte Geschichte aufzuweisen. 1855 haben Braunschweiger Bürger sie dem beliebten Regenten Wilhelm anlässlich dessen 25-jährigen Thronjubiläums geschenkt. Den Krieg hat die Quadriga fast unversehrt überstanden, aber nicht die Buntmetalldiebe. Eine Stiftung hat die Quadriga im Rahmen der Errichtung der Schloss-Arkaden mit einem in Dresden noch vorhandenen Originalmodell neu gießen lassen.
Der Giebel stellt Heinrich den Löwen in den Mittelpunkt.
Aber nicht so, wie die Geschichtsschreibung ihn gerne darstellt. Er hat
die Christianisierung mit allen Mitteln durchgedrückt und seine eigenen
Interessen in den Vordergrund gerückt.
Die Reiterstatuen vor dem Schloss zeigen Herzöge der neueren Zeit. Die
eine Statue: Herzog Karl-Wilhelm-Ferdinand. Der ist 1806 in der Schlacht
von Jena und Auerstedt verletzt worden und ist an den Verletzungen
gestorben. Die Schlacht war bis dahin nicht entschieden, die Verletzung
des Herzogs hat ggf. für Napoleon eine positive Wende bewirkt. Die andere
Statue: Der schwarze Herzog Friedrich Wilhelm. Auch ein Patriot
gegen Napoleon. Gefallen 1815 am Vorabend der
Entscheidungsschlacht in Waterloo.
Der Bohlweg, über den
Nachtwächter Rudolf die Exkursion nach dem Schloss zum
Braunschweiger Rathaus führte, kennzeichnet die Sümpfe, die es hier
in früherer Zeit gab. Das Rathaus
befindet sich am Platz der Deutschen
Einheit. Der Bau wurde zwischen 1894 und 1900 nach Plänen des
Stadtbaurates Ludwig Winter im Stil der Neogotik errichtet. Die
Konstruktion des Turms hat er in Belgien abgesehen. Zunächst ist er
bezüglich des Turms am Rathaus am Geld gescheitert, aber er konnte sich
mit seinem Konzept durchsetzen. Als Dank hat er sein Büro im Turm über dem
Amtszimmer des Bürgermeisters eingerichtet.

Ludwig Winter hat auch die Burg
Dankwarderode wieder aufgebaut, eine sächsische Burg. Sie
war über Jahrhunderte Residenz der Braunschweiger Herzöge und ist heute
Teil des Herzog Anton Ulrich-Museums. Ludwig Winter hat sich das Geld für
den Bau der Burg bei den Preußen in Person Prinz Albrechts von Preußen
besorgt. Der Preis: Parkettboden im Obergeschoss. Albrecht wollte tanzen.
Der Plan Winters, die Burg nach dem Original Heinrichs des Löwen
aufzubauen, war ein wenig eingebrochen. Geschickt hat Winter die
kleine Kirche St. Peter und Paul
integriert, die Heinrich der Löwe vor dem Bau des Doms nach englischem
Vorbild an der Burg Dankwarderode errichten ließ und die zu Zeiten
Heinrichs des Löwen schon wieder abgerissen wurde. Aus Platzmangel
hat Winter nur einen Turm errichtet und den anderen Turm angedeutet.
1173 war Heinrich der Löwe bei den Staufen noch gut im Rennen. Nach einer
Pilgerreise mit wenig Gefolge (1500 Mann!) kam er mit vielen Reliquien und
der Idee zurück, eine größere Kirche zu bauen. Das wurde der heutige Dom, vor dem die Exkursionsgruppe
jetzt stand. Aber wie schon ausgedrückt nur eine Kirche für
ihn und ggf. einige Adlige. Und sie sollte Grabeskirche für ihn
sein. Das wurde sie auch, eine Grabplatte im Dom zeigt die Stelle, wo er
1195 nach seiner zweiten Frau Mathilde von England bestattet wurde.
Bereits 1166 ließ Heinrich der Löwe das Löwendenkmal
auf dem Burgplatz errichten. Es
ist heute das älteste im Freien stehende Denkmal nördlich der Alpen.
Entsprechend passt nicht eine der Legenden, wie Heinrich zum Beinamen „der
Löwe“ kam, nach der der Löwe ein dankbarer Löwe nach einer
Pilgerreise war und die Kratzspuren am Domeingang nach dem Tode des
Herzogs entstanden sind. Die anderen Geschichten erscheinen plausibler.
Eine von den Gebrüdern Grimm, die andere von Thomas Ostwald. Aber
die hat Nachtwächter Rudolf (Thomas Ostwald)nicht erzählt. Er wird sie
vorspielen. Auch 2018. Zu Pfingsten mit einer Laienspielschaar von
100 Leuten. Dieses Event kann man sich eigentlich nicht entgehen lassen.
Das letzte Event des Rundganges: Das Verlagshaus des bekannten Verlages Vieweg (heute beherbergt das Haus das Braunschweigisches Landesmuseum), das Huneborstelsche Haus und das von Veltheimsche Haus auf dem Burgplatz. Im Jahre 1524 ließ der Braunschweiger Friedrich Huneborstel in dem Weichbild Sack das Huneborstelsche Haus errichten. Das heutige Gildehaus ist ein reich verziertes Fachwerkhaus. Die Fassade besteht aus reich geschnitzten Figurenfriesen und Knaggen. Das Von Veltheimsche Haus ist ein Fachwerkhaus aus dem Jahre 1573. Ein Haus mit drei Wohngeschossen und seitlicher Durchfahrt, ohne Zwischengeschoss und Speicher. Das Haus zeigt eine Auslucht (ein Frauensitz mit Ausblick auf die Straße; natürlich nur für reiche Frauen). Die Obergeschosse sind vorkragend.

Die verfügbare Zeit des Nachtwächters und die der
Exkursionsgruppe sind abgelaufen. Der Nachtwächter muss die imaginären
Stadttore schließen. Die Exkursionsgruppe ist in „Kuh-Acht“ zu einem
Abendessen verabredet.
Thomas Ostwald verabschiedet sich mit einem Hinweis auf weitere
schöne und interessante Bereiche der Braunschweiger Altstadt und mit
einem Hinweis auf das bekannte Braunschweiger Bier, die
Braunschweiger Mumme.
Mit einem herzlichen Beifall wird er von der Exkursionsgruppe verabschiedet.
Die Exkursionsgruppe hatte für diesen Tag genug gesehen und gehört, jetzt war nur noch die Exkursion in das Restaurant "Kuh-Acht" wichtig.
Eine kleine Gruppe der Exkursionsteilnehmer nutzte den Aufenthalt in
Braunschweig zur Fortsetzung des Altstadtrundganges am 24. Juli 2017.
Diesmal ohne Begleitung durch Herrn Ostwald. Ausgangspunkt war der
Turm des Rathauses.
Fotogalerie
des Rundganges am 24. Juli 2017 mit detaillierten Bildtexten.
Weblinks
http://www.arbeitsausschuss-tourismus.de/mitglieder/thomas-ostwald
Braunschweig
im 18. Jahrhundert
Der
Nußberg bei Braunschweig
Der Dom St. Blasius in Braunschweig
Letzte Änderung: 18.08.2020